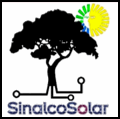Welcome · Benvenuto · Willkommen · Bienvenue
Home


Photovoltaik: Strom aus Sonnenlicht
Bei der Photovoltaik wird das Sonnenlicht in den Solarzellen der Solarmodule,
direkt in elektrischen Strom umgewandelt. In der Regel werden mehrere
Solarmodule zu einem so genannten Solargenerator verbunden. Der Gleichstrom
dieses Generators kann verschieden genutzt werden. Bei netzgekoppelten
Solarstromanlagen wird er mit Hilfe eines Netzeinspeisegeräts in Wechselstrom umgewandelt und in das Stromnetz eingespeist. Bei netzunabhängigen Solarstromanlagen wird der Strom oft in Batterien gespeichert und bei
Bedarf entweder direkt, oder mit Hilfe eines Wechselrichters als Wechselstrom,
zur Verfügung gestellt.
Photovoltaik-Anlagen können sowohl netzgekoppelt als auch netzunabhängig konzipiert werden. Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf der grünen Wiese mit Anschluss an das öffentliche Stromversorgungsnetz leisten einen umweltfreundlichen Beitrag zu
unserer Stromversorgung. Einmal installiert, erzeugt eine Solarstromanlage
jahrzehntelang elektrische Energie mit der Sonne als zuverlässigster Energiequelle der Welt. Ein wesentlicher Vorteil des
Netzparallelbetriebes besteht darin, dass der erzeugte Solarstrom in das
Versorgungsnetz des Energieversorgers eingespeist werden kann. Das Netz liefert
wie gewohnt die benötigte Energie, auch wenn die Sonne nicht scheint.
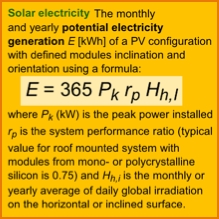


Historisches zur Photovoltaik
Der photoelektrische Effekt wurde bereits im Jahre 1839 von
dem französischen Physiker Alexandre Edmond Becquerel
entdeckt. 1876 wiesen William G. Adams und Richard E. Day diesen Effekt auch bei
einem Selenkristall nach.
1905 gelang es Albert Einstein, den Photoeffekt richtig zu erklären, wofür er 1921 den Nobelpreis für Physik bekam. Nach vielen weiteren Entdeckungen und Entwicklungen gelang es
dann 1954 Daryl Chapin, Calvin Fuller und Gerald Pearson, die ersten
Siliziumzellen, mit Wirkungsgraden von über vier Prozent, zu produzieren, eine Zelle erreichte sogar einen Wirkungsgrad
von sechs Prozent. Die erste technische Anwendung wurde Ende der 1950er Jahre
mit dem Vanguard I in der Satellitentechnik gefunden.
In den 1960er und 1970er Jahren gab es, in erster Linie durch die Nachfrage aus
der Raumfahrt, entscheidende Fortschritte in der Entwicklung von
Photovoltaikzellen.
Ausgelöst durch die Energiekrisen in den 1970er Jahren und das gestiegene
Umweltbewusstsein wird verstärkt politisch versucht, die Erschließung dieses Energiewandlers durch technische Fortschritte auch wirtschaftlich
interessant zu machen. Führend sind hierbei die USA, Japan und insbesondere die Bundesrepublik
Deutschland, welche mit gesetzlichen Maßnahmen wie dem 100.000-Dächer-Programm und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhebliche finanzielle Anreize bietet.
Das 100.000-Dächer-Programm lief Mitte 2003 aus und wurde Anfang 2004 durch die Änderung beziehungsweise Novellierung des EEG kompensiert. Die Einspeisevergütung wurde entsprechend angehoben. Im Jahr 2005 erreichte die gesamte
Nennleistung der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen 1 Gigawatt.
Die Technik hinter der Voltaik
Die als Licht und Wärme auf die Erde auftreffende Menge an Sonnenenergie beträgt jährlich 1,5 · 1018 kWh; dies entspricht in etwa dem 15.000-fachen des gesamten Primärenergieverbrauchs der Menschheit im Jahre 2006 (1,0 · 1014 kWh/Jahr). Der Lichtenergieeintrag durch die Sonne beträgt pro Jahr etwa 1,1 · 1018 kWh. Diese Strahlungsenergie kann prinzipiell aufgefangen und teilweise in
Elektrizität umgewandelt werden, ohne dass Nebenprodukte wie Abgase (beispielsweise
Kohlendioxid) entstehen. Der Wellenlängenbereich der auftreffenden elektromagnetischen Strahlung reicht vom
kurzwelligen, nicht sichtbaren Ultraviolett (UV) über den sichtbaren Bereich (Licht) bis weit in den langwelligeren infraroten
Bereich (Wärmestrahlung) hinein. Bei der Umwandlung wird der photoelektrische Effekt
ausgenutzt.
Die Energiewandlung findet mit Hilfe von Solarzellen, die zu so genannten
Solarmodulen verbunden werden, in Photovoltaikanlagen statt. Die erzeugte
Elektrizität kann entweder vor Ort genutzt, in Akkumulatoren gespeichert oder in Stromnetze
eingespeist werden. Bei Einspeisung der Energie in das öffentliche Stromnetz wird die von den Solarzellen erzeugte Gleichspannung von
einem Wechselrichter in Wechselspannung umgewandelt. Mitunter wird eine
alleinige Energieversorgung mittels Photovoltaik in Inselsystemen realisiert.
Um hier kontinuierlich Energie zur Verfügung zu stellen, muss die Energie gespeichert werden. Ein bekanntes Beispiel für akkumulatorgepufferte Inselsysteme sind Parkscheinautomaten.
Die photovoltaische Energiewandlung ist wegen der Herstellungskosten der
Solarmodule im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken deutlich teurer, wobei allerdings große Teile der Folgekosten der konventionellen Energiewandlung nicht in die
heutigen Energiepreise mit eingehen. Das stark schwankende Strahlungsangebot
erschwert den Einsatz der Photovoltaik. Die Strahlungsenergie schwankt
vorhersehbar tages- und jahreszeitlich bedingt, sowie täglich abhängig von der Wetterlage. Beispielsweise kann eine fest installierte Solaranlage
in Deutschland im Juli einen gegenüber dem Dezember bis zu fünfmal höheren Ertrag bringen. Sinnvoll einsetzbar ist die photovoltaische
Energiewandlung als ein Baustein in einem Energiemix verschiedener
Energiewandlungsprozesse. Ohne die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Energiespeicherung im großen Maßstab werden hierbei konventionelle Elektrizitätswerke nicht völlig zu ersetzen sein. Das Stromeinspeisungsgesetz und insbesondere das
Erneuerbare-Energien-Gesetz haben zu einem Boom bei der Errichtung von
Photovoltaikanlagen in Deutschland geführt. So wurde Ende Juni 2005 die Schwelle von 1000 MW installierter elektrischer
Nennleistung von Photovoltaikanlagen überschritten, das entspricht einer Verhundertfachung in den letzten zehn Jahren.
Eingeschränkt wird die Verfügbarkeit durch verschiedene Faktoren, wie geographische Breite, Jahreszeit,
Tageszeit, Wetterlage (zum Beispiel Umgebungstemperatur, Wolken, Lufteintrübung) und Verschattung durch Aufbauten, Bäume, Fahnenmasten und ähnliches.
Solarstrom kann durch Photovoltaikanlagen oder auch mit Sonnenwärmekraftwerken generiert werden. Die wichtigsten Kraftwerkstypen sind
Solarfarmkraftwerke, Solarturmkraftwerke, Dish-Stirlingmotor-Anlagen und
Thermikkraftwerke.






Die Nennleistung von Photovoltaikanlagen
Diese wird häufig in Wp (Wattpeak) beziehungsweise kWp angegeben. „peak“ (engl. Höchstwert, Spitze) bezieht sich auf die Leistung bei Testbedingungen, die nicht
der Leistung bei höchster Sonneneinstrahlung entspricht. Die Testbedingungen dienen zur Normierung
und zum Vergleich verschiedener Solarzellen oder -module. Die elektrischen
Werte der Bauteile unter diesen Bedingungen werden in den Datenblättern angegeben. Es wird bei 25 °C Modultemperatur, 1000 W/m² Bestrahlungsstärke und einer Luftmasse von 1,5 gemessen. Dies sind die Standard-Testbedingungen
(meist abgekürzt STC, engl. Standard-Test-Conditions), die als internationaler Standard
festgelegt wurden. Können diese Bedingungen beim Testen nicht eingehalten werden, so muss aus den
gegebenen Testbedingungen die Nennleistung rechnerisch ermittelt werden. Die
Bestrahlungsstärke von 1000 W/m² kommt in Mitteleuropa über ein Jahr gesehen nicht sehr häufig vor (je weiter südlich, desto häufiger). Im normalen Betrieb haben Solarmodule beziehungsweise die Solarzellen
bei dieser Einstrahlung eine wesentlich höhere Betriebstemperatur als die im Test vorgesehenen 25 °C und damit auch einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad.
Die zu erwartende mittlere Produktion an elektrischer Energie einer jeweils neu
errichteten netzgekoppelten Photovoltaik-Anlage in Deutschland steigt seit
Jahren mit Verbesserung der Technik kontinuierlich an und liegt derzeit bei
sinnvoller Auslegung der Anlage bei Werten zwischen 700 und 1000 kWh pro kWp und Jah, bei den durchschnittlich älteren Anlagen im Bestand liegen die Werte zwischen 550-820 kWh pro kWp und
Jahr. Für eine Nennleistung von 1 kW werden Solarzellen mit einer Fläche von etwa 8-10 m² benötigt. Daraus ergibt sich für eine neue Anlage ein tatsächlicher Energieertrag von etwa 70-125 kWh pro Quadratmeter und Jahr (entspricht
einer mittleren Leistungsabgabe von 8 bis 14,3 W).
Der Wechselrichter aus Gleich- wird Wechselstrom
Der vom PV-Generator erzeugte Gleichstrom wird vom Wechselrichter in netzüblichen Wechselstrom umgewandelt. Der Wechselrichter hat noch zusätzliche Aufgaben. Er sorgt dafür, dass zu jedem Zeitpunkt das bestmögliche Verhältnis aus Spannung und Stromfluss im Generator vorliegt und damit größtmögliche Energiemenge erzeugt wird (MPP-Tracking). Überwachungs- und Schutzeinrichtungen werden ebenfalls vom Wechselrichter erfüllt.
Die Qualität von PV-Modulen
Die mit Solarzellen in der Photovoltaik erzielten Wirkungsgrade reichen von
wenigen Prozent (beispielsweise etwa 6 Prozent für Cadmium-Tellurid-Solarmodule) bis hin zu über 35 Prozent (Konzentrator-Mehrschicht-Laborexemplar) oder über 40 Prozent.
Die Wirkungsgrade marktüblicher Solarmodule liegen zwischen 6 Prozent (Dünnschichtmodule auf Siliziumbasis) und 18,5 Prozent (monokristalline Module).
Der Systemwirkungsgrad im Jahresverlauf ergibt sich dann aus der Multiplikation
mit der Performance Ratio (PR). In diese fließen die Verluste des Wechselrichters ebenso mit ein wie Abschattungen und
Verluste durch hohe Temperaturen. Die PR liegt im Bereich von 0,7 bis 0,85.
Obwohl die insgesamt zur Verfügung stehende Sonneneinstrahlung immens hoch erscheint, ist die Photovoltaik
aufgrund des bisher niedrigen Wirkungsgrades sehr flächenintensiv. So erzeugt eine Windkraftanlage mit 5 MW Leistung etwa genauso
viel Energie wie eine 500 m × 500 m (25 ha) große Solarstromanlage. Dennoch ist auch heute schon die Leistungsdichte der
Photovoltaik höher, da Windkraftanlagen dieser Größe in mehr als 500 Meter Abstand voneinander aufgestellt werden müssen. Allerdings steht die Fläche unter und um Windkraftanlagen weiterhin zur Energiegewinnung durch
Photovoltaik oder Biomasse (solarer Wirkungsgrad 0,1 bis 0,24 %) zur Verfügung.
Von Kritikern der Solarstromtechnologie wird der – im Vergleich mit einer konventionellen Umwandlung fossiler Energieträger – vergleichsweise geringe Wirkungsgrad als Argument gegen die generelle
Tauglichkeit der Photovoltaik angeführt. Bei der Betrachtung des Energie-Wirkungsgrades eines Systems sind
aufzuwendende Kosten für die Primärenergie, sowie die Übertragungs- und Umwandlungsverluste zu berücksichtigen. Anders als bei klassischer Energieerzeugung steht hier die
Sonneneinstrahlung als Primärenergieträger kostenlos zur Verfügung und ein geringer Wirkungsgrad hat – außer im Flächenverbrauch – keine Auswirkung auf die Umweltbelastung. Gerade die preiswerteren,
polykristallinen Module, mit vergleichsweise geringem Wirkungsgrad, können z. B. auf Industrie-Flachdächern ohne Landschaftsverbrauch vergleichsweise einfach mit integrierten
Dachabdeckungssystemen verlegt werden. Im Vergleich zu aufgeständerten Anlagen, mit hochwertigen monokristallinen Systemen, entsteht so kein „Landschaftsverbrauch“. Auch ist der Energieaufwand zur Herstellung hochwertiger Photovoltaikmodule höher als bei Dünnschichttechnologien mit geringerem Wirkungsgrad.
Solarmodule erzeugen immer Gleichstrom mit einer niedrigen Spannung, für die es kaum geeignete Verbraucher gibt. Die meisten elektrischen
Energieverbraucher sind auf Wechselstrom (z. B. im Haushalt 230 V, 50 Hz)
angewiesen, da das Energieversorgungssystem aus verschiedenen technischen Gründen (Transformatoren, Drehstrommotoren und Sicherheit) in Wechselstromtechnik
gebaut wurde. Bei der Umwandlung und Übertragung des Gleichstroms in Wechselstrom entstehen Verluste (meist 3 bis 7
%). Als Umwandler werden Wechselrichter verwendet. Dies sind – technisch gesehen – starke Oszillatoren der Frequenz 50 Hz. Ohne diese ließe sich der erzeugte Strom nicht in das öffentliche Netz einspeisen.
Bei einem Einsatz in Deutschland wird die Energie, die zur Herstellung einer
Photovoltaikanlage benötigt wird, in zwei bis sieben Jahren wieder hergestellt. Der Erntefaktor liegt
zwischen 1,5 und 38. Die Lebensdauer wird auf 30–40 Jahre geschätzt. Der energieintensive Teil der Solarzelle kann 4- bis 5mal wiederverwertet
werden.